Die Hohenzollern
Eine Dynastie, die Deutschland prägte
Heft 2/2011 aus der Reihe „DER SPIEGEL – GESCHICHTE“ März 2011 7,50 €
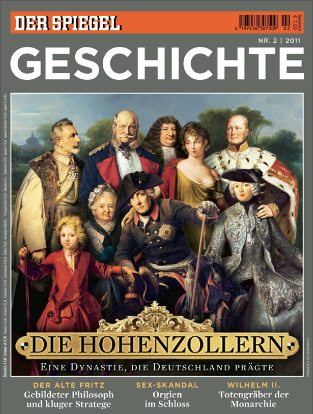
Seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Hohenzollern im Jahr 1061 sind mittlerweile 950 Jahre vergangen. Offenbar aus diesem Grund hat DER SPIEGEL dem Adelshaus unter der Überschrift „Eine Dynastie, die Deutschland prägte“ eines seiner „Geschichte“-Hefte (Nr. 2/2011; 7,50 €) gewidmet, das allerdings den Schwerpunkt auf die letzten 150 Jahre legt. Von den 146 Seiten beschäftigen sich immerhin fast 50 mit Wilhelm II. und seiner Zeit. Für die „vorpreußischen“ Anfänge gibt es zehn Seiten, für die Zeit zwischen dem Großen Kurfürsten und Wilhelm I. wieder lediglich 50.
Daß für diese Schwerpunktsetzung auch (neben den verkaufstechnischen) geschichtspädagogische Gründe ausschlaggebend gewesen sein dürften, wird bereits im Interview mit Johannes Kunisch deutlich. Eigentlich geht es darin um Friedrich den Großen, über den der Kölner Historiker eine Biographie geschrieben hat. Doch die SPIEGEL-Redakteure versuchen mehrfach, in Friedrich II. bereits Hitler heraufzubeschwören: „Der preußische Regent hat andere Länder ohne Kriegserklärung angegriffen und mit Durchhalteparolen Krieg geführt, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Das erinnert an Adolf Hitler, der im September 1939 im eroberten Danzig verkündete, er stehe für ein ‚friderizianisches Deutschland‘.“ Kunisch weist diese Assoziation zwar zurück, aber der Name Hitler ist gefallen und wird für den Rest der Lektüre im Hinterkopf des Lesers bleiben. Einig sind sich SPIEGEL und Kunisch darin, daß spätestens mit Wilhelm II. der Abstieg Preußens begann und daß das „Preußentum Friedrichs in der wilhelminischen Ära […] pervertiert“ wurde.
Umso erstaunlicher ist es dann, daß die wilhelminische Epoche mit einem sehr ausgewogenen Beitrag über den Kaiser selbst eröffnet wird. Der Autor, Frank-Lothar Kroll, Historiker in Chemnitz, ist bekannt dafür, der Objektivität den Vorzug zu geben: „Das Reich, dem er [Wilhelm II.] als Staatsoberhaupt präsidierte, befand sich auf dem Gipfel seiner weltpolitischen Machtstellung. Wirtschaft, Wissenschaft und Gelehrsamkeit blühten wie kaum jemals zuvor. Und auch das politische System wurde, bei aller Reformbedürftigkeit im Einzelnen, von der Bevölkerungsmehrheit akzeptiert.“ Krolls Charakterisierung des Kaisers spart dessen Schwächen nicht aus, ohne deshalb ein einseitiges Bild zu zeichnen. Vielmehr werden die Stärken und Leistungen des Kaisers ausführlich gewürdigt, innenpolitisch insbesondere seine Bemühungen um die Lösung der „sozialen Frage“ und seine Verdienste in der Wissenschaftspolitik. Für die Außenpolitik stellt Kroll fest, daß Wilhelm die wenigsten Fehlschläge selbst verschuldet habe: ob die Nichtverlängerung des Rückversicherungsvertrags mit Rußland, die Krüger-Depesche, die Marokko-Krisen oder die „Daily Telegraph“-Affäre – meistens war er gegen seine Überzeugung den Forderungen der Berater gefolgt, die ihn dann nicht selten im Regen stehen ließen. Diese mangelnde Durchsetzungsfähigkeit sollte sich beim Ausbruch und Verlauf des Ersten Weltkriegs als verheerend erweisen.
In den folgenden Beiträgen zur wilhelminischen Epoche finden sich zahlreiche Aussagen, die im Widerspruch zu Krolls Bild des Kaisers stehen. Abgesehen davon, daß die „Skandal im Jagdschloß Grunewald“-Geschichte noch einmal aufgewärmt wird, um die Epoche als Ganzes moralisch zu diskreditieren, versucht vor allem Michael Sontheimer in seinen beiden Beiträgen (zum Ersten Weltkrieg und zur Flottenpolitik) die Sicht auf Wilhelm II. im Sinne der historischen Korrektheit wieder zurechtzurücken. Der Historiker und taz-Mitgründer Sontheimer ist sich seiner Sache allerdings auch nicht mehr so sicher, wie das noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen sein mag – von Alleinschuld am Ersten Weltkrieg redet auch er nicht mehr. Allerdings gibt es auch für die Hauptschuld, an der Sontheimer für Wilhelm II. und seine Administration festhält, keine Belege. Jedenfalls kann er keine vorweisen. Er beruft sich für sein Urteil ausgerechnet auf Fritz Fischer, dessen Hauptschuld-These von 1961 („Griff nach der Weltmacht“) schon mehrfach widerlegt worden ist. Doch Sontheimer kennt die neuere Literatur zu diesem Thema offenbar nicht und kann sich auch in die Situation von 1914 nicht hineindenken. Deshalb hält er die Überzeugung von Wilhelm II., daß „England, Russland, Frankreich“ sich verabredetet hätten, den „österreichisch-serbischen Konflikt zum Vorwand nehmend“, um gegen Deutschland den „Vernichtungskrieg zu führen“ für eine „Wahnidee“. Wie sehr diese Vermutung Wilhelms den Tatsachen entsprach, haben englische Historiker (Niall Ferguson, John Keegan) später herausgearbeitet. Daß Deutschland auf den Krieg denkbar schlecht vorbereitet war und nur den alten Schlieffenplan von 1905 in der Schublade hatte, nimmt Sontheimer als Indiz für die Überheblichkeit der deutschen Führung, ohne auf die historischen Hintergründe dieses Plans und seiner Entstehung hinzuweisen.
Wie sehr Sontheimer sich die Sicht der Alliierten zu eigen gemacht hat, zeigt sich in dem Beitrag über die Flottenpolitik. So hat er vollstes Verständnis für die britische Auffassung, daß ihre Flotte immer mindestens so groß sein müsse wie die beiden nächstgrößeren Flotten zusammen. Daß man das auch als Anmaßung verstehen könnte, kommt ihm nicht in den Sinn. Mit dem Unterton der Entrüstung schreibt er: „Auf der Grundlage ihrer deutlichen Überlegenheit wollten die Briten Rüstungsbegrenzungen mit den Deutschen vereinbaren, doch diese lehnten ab.“ Mit anderen Worten: Wie konnten es die Deutschen wagen, auf so ein freundliches Angebot nicht einzugehen? Womit die Schuldfrage dann ja auch ganz konkret geklärt wäre. (Auch Sontheimers Hinweis, daß die deutschen Schiffe das „SMS“, Seiner Majestät Schiff, vor dem Namen führten, soll wohl sagen: Hier hat sich Wilhelm seine Privatflotte bauen lassen. Daß es bei den Briten bis heute Her Majesty’s Ship heißt, verschweigt er dem Leser natürlich.)
Im Anschluß an Sontheimer darf der pensionierte SPIEGEL-Redakteur Hans-Joachim Noack dann die üblichen Klischees aus der Exilzeit des Kaisers verbreiten: der holzhackende Nazisympathisant Wilhelm in Doorn.
Daß die Hohenzollern in der bundesrepublikanischen Gegenwart angekommen sind, soll schließlich das Interview mit dem Urenkel des Kaisers, dem enterbten Thronprätendenten Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen belegen, der sich natürlich als Republikaner bekennt (was sein gutes Recht ist). Daß die Frage, ob er Demokrat sei, nicht auch noch gestellt wird, hat vermutlich damit zu tun, daß man das in SPIEGEL-Kreisen für selbstverständlich hält oder daß man den Unterschied zwischen Republik und Demokratie nicht kennt. Der Prinz irrt allerdings, wenn er behauptet, daß zu Zeiten seines Vaters (Louis Ferdinand, 1907-1994) „weniger als ein Prozent der Deutschen für die Monarchie“ waren. Zumindest in den fünfziger Jahren wollten laut Allensbach-Umfragen ein Drittel der Deutschen den König bzw. Kaiser wiederhaben.
 Und schließlich muß auch er seinem Urgroßvater etwas Schlechtes nachrufen: „Er war ein Unglück – für Deutschland und für unsere Familie. 1888 bestieg er den Thron, 30 Jahre später hatte er die Monarchie verspielt.“
Und schließlich muß auch er seinem Urgroßvater etwas Schlechtes nachrufen: „Er war ein Unglück – für Deutschland und für unsere Familie. 1888 bestieg er den Thron, 30 Jahre später hatte er die Monarchie verspielt.“
Trotz aller Bemühungen der seriösen Wissenschaft in den letzten Jahren, diese Auffassung zu widerlegen, dürfte sie weiterhin konsensfähig sein – und auch noch eine ganze Weile bleiben. Nicht umsonst ist DER SPIEGEL das Leitmedium der Bundesrepublik, der die Meinung der Mehrheit zugleich bestimmt und wiedergibt. Deshalb sollte, wer sich über Wilhelm II. und seine Familie unvoreingenommen informieren will, die Finger von diesem Heft lassen (und sich statt dessen das nur 1,50 € teurere Büchlein „Die Hohenzollern“ (C.H. Beck 2008; 8,95 €) von Frank-Lothar Kroll besorgen).