„Ohne mich könnt ihr nichts tun!“
Ansprache seiner Majestät des Kaisers an die Hausgemeinde zu Haus Doorn am Sonntag, dem 18. Mai 1930
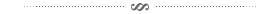
„Ohne mich könnt ihr nichts tun!“
„Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Joh. 15,5)
Ohne mich könnt Ihr nichts tun! – ein schwerwiegendes, tiefernstes Wort!
Ohne mich könnt ihr nichts tun!
Widerspricht dieses Wort nicht der ganzen Lebensauffassung unserer heutigen Zeit? Ein jeder glaubt, aus sich heraus leben und wirken zu können. Zu schrankenlosem Ausleben und Hinstürmen sucht ein jeder nach Geld, Ruhm und Ehre.
Wie der Verkehrsschutzmann auf der Straße die dahinrasenden Autos, Räder, vorwärts drängenden Fußgänger mit einem Schlage durch das Stop-Signal anhält – alles steht plötzlich wie festgewurzelt – so steht dieses gewaltige Wort gleichfalls als ein Stop-Signal plötzlich vor uns und ruft den auf dem rollenden Teppich des Lebens dahingleitenden Menschen zu: „Halt! Wo willst du hin? Besinn dich!“
„Ohne mich könnt ihr nichts tun!“ – wer ist der Mann, der uns dieses mächtige Wort zuruft?
Es ist Jesus Christus, unser Herr und Heiland, der Weltenretter und Erlöser!
Vor fast 2000 Jahren hat er dieses Wort zu seinen Jüngern im Anschluß an das Gleichnis vom Weinstock gesprochen.
So lange die Reben nur gedeihen können, so lange sie eng mit dem Weinstock verwachsen sind und ihre Kraft aus ihm ziehen, so will der Herr seinen Jüngern und uns vor Augen führen, daß ohne diese enge Verwachsenheit mit ihm und ohne seine göttliche Kraft all unser Tun und Wirken vergeblich ist.
Schon einmal hat der Herr seine Jünger auf ihre Hilflosigkeit ohne ihn hingewiesen. Als sie auf dem See Genezareth – auf ihre eigene Kraft vertrauend – voller Zuversicht dahinfuhren, wie sie aber, als ein gewaltiger Sturm aufzog, sich vor ihm zu Füßen werfend angstvoll riefen: „Herr, hilf, wir verderben!“
Schon damals zeigte er ihnen mit den Worten: „Oh ihr Kleingläubigen …“, daß sie ohne Ihn nichts tun könnten.
In der heutigen Zeit ist man geneigt, die Unterschiede der einzelnen Religionen als unbedeutend hinzustellen, da sie alle von Gott wissen und reden. Man meint, Christentum, Judentum, Islam und Buddhismus hätten alle manche gute Eigenschaft und wären einander sehr ähnlich. Es sei kein großer Unterschied zwischen einem gläubigen Israeliten, einem gläubigen Mohammedaner, einem gläubigen Juden, die Tüchtiges leisten und gute Menschen sein könnten.
Das ist grundfalsch. Denn sie wissen alle nicht von Sünde und Sündenvergebung. Allein das Christentum predigt den Erlöser, den Herrn Jesus Christus, den Gottessohn, der von Gott als Gnadengeschenk zu den Menschen herabgesandt ward, um sie von ihren Sünden zu erlösen und ihnen den Zugang zu Gott wieder zu öffnen. Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt sind rein christlich!
Eines hat allein das Christentum:
Jesus Christus selbst.
In seiner Person als dem Gottessohn und Erlöser ist unser christlicher Glaube fest verankert. Mit ihm steht und fällt unsere christliche Religion. Christus vergibt uns unsere Sünden, weist uns den Weg nach oben zu unsrem himmlischen Vater und führt uns zur Gotteskindschaft, zur Gottgebundenheit. Also unser Führer will er sein.
Führer sein! Das will heutzutage jeder! Führer bieten sich aller allerorten an. Als Führer spielen sich viele auf, lassen sich viele nennen. Und dennoch überall der Schrei nach Führern. Warum? Weil die Gottgebundenheit bei ihnen nicht vorhanden ist!
Nach der weltlichen Entwicklungslehre soll der Führergedanke aus dem Ichbewußtsein des Menschen stammen. Der stärkste Mann mit der größten Keule, dem schärfsten Schwert, dem längsten Speer sammelt andere unter sich, oft mit Zwang, faßt so allmählich die Sippe, den Stamm, ein Volk zusammen und lenkt sie nach seinem Willen; schrankenlos und ohne Hemmungen übt der Führer den anderen gegenüber sein Amt aus, kraft seines Ichbewußtseins. Diese Erklärung für die Entstehung des Führergedankens ist einseitig, nicht erschöpfend.
Der von Gott den Menschen – wie es scheint zuerst den Sumerern – geoffenbarte Führergedanke beruht auf der Beschränkung, die dem Führer von Gott selbst auferlegt worden ist, indem er sich Gott gegenüber verantwortlich fühlt für das Herrscheramt, das er über andere ausübt und für alles, was er in demselben tut.
„Von Gottes Gnaden“ bedeutet: Führen im Auftrage Gottes, im Gefühl der Verantwortlichkeit Gottes ihm gegenüber, unter seiner Kontrolle, gehemmt und gebunden durch dieselbe, der man Rechenschaft schuldigt.
Das hat schon vor mehreren tausend Jahren der euch von meinen früheren Ausführungen über die alten Sumerer bekannte sumerische König Hammurabi, dessen Zeitgenosse Abraham war, empfunden und zum Ausdruck gebracht.
Am Eingang seiner Gesetze, die auf einer Steinsäule eingegraben auf dem Marktplatz standen, betont er zum ersten Mal, daß er als Herrscher von Gott den Auftrag erhalten habe, die Welt für Ihn in Ordnung zu halten, Gerechtigkeit zu üben, den Schwachen zu schützen, den Starken einzuschränken, den Feind abzuwehren, den Wohlstand zu mehren, den Frieden zu wahren und anderes mehr. Von diesen einzelnen Gesetzen hat übrigens später Moses einige in das Mosaische Gesetz übernommen.
Dieses war die erste grundlegende Bestätigung des „Gotteskönigtums“, des „Gottesgnadentums“ seitens eines Herrschers im Verantwortungsbewußtsein gegen Gott. Dieses Verantwortlichkeitsbewußtsein ihrem Gott gegenüber haben in ausgeprägten Maße stets die Fürsten der Germanen gehabt, zu denen Karl der Große den Gottesgnaden-Gedanken brachte. Und im Laufe der Zeit lautetet es auf Münzen und Urkunden von Kaiser, Königen und Fürsten: Dei gratia – von Gottes Gnaden.
Von Gott berufen, aber damit an ihn gebunden. Führung und Arbeit ist Gottgebundenheit.
Im Gegensatz dazu steht die Herrschaft der römischen Cäsaren und der Napoleoniden.
Diese Gottgebundenheit und Gottesaufgabe ihres Führerberufes haben meine Vorfahren, die Hohenzollern, 500 Jahre lang unentwegt befolgt.
Schon Kurfürst Friedrich I. erklärte, als er 1417 mit der Mark [Brandenburg] belehnt worden war:
„Ich bin der schlichte Amtsmann Gottes.“
Diesem Grundsatze sind die Hohenzollern treu geblieben, ob sie bedeutend oder unbedeutend waren – wir sind alle Menschen und haben Schwächen und Fehler.
Dem Grundsatz des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., „Der Staat bin ich“, steht das Wort Friedrichs des Großen gegenüber: „Ich bin der erste Diener meines Staates.“ Kaiser Wilhelm der Große [gemeint ist Wilhelm I., der Großvater Wilhelms II.] sprach diese Gottgebundenheit bei der Kaiserproklamation in Versailles [1871] aus, indem er auf die ihm übertragende Gottesaufgabe hinwies, und seine Erklärung entspricht nicht nur dem Sinne nach, sondern zeigt auch gewisse Ähnlichkeit mit den Bestimmungen des alten Königs Hammurabi auf seinen Gesetzestafeln: Gerechtigkeit zu üben, die Schwachen zu beschützen, den Starken einzuschränken […]
1871 Kaiser Wilhelm der Große – und fast 5000 Jahre früher König Hammurabi: von Gottes Gnaden!
Allen diesen Führern ist wiederum der Führer Jesus Christus. Er vermittelt ihren Seelen Gotteskraft, schärft das Verantwortungsbewußtsein, damit sie so handeln wie das von ihnen stets wachgehaltene Gewissen es verlangt, damit sie das Wort wahr machen: „Du sollst ein Segen sein!“
„Dei Gratia“ – ist ein jeder von uns an seiner Stelle, adelt das jede Arbeit. Ein jeder von uns hat das ihm zugewiesene Amt von Gottes Gnaden empfangen und ist Gott verantwortlich. Das trifft nicht nur für den Fürsten und Führer zu, das gilt auch für den schlichten Arbeiter.
Jeder hat sein Amt von Gottes Gnaden. Im Gegensatz zu der jetzt üblichen Auffassung: „Volksbeauftragter von Volkes Gnaden!“ – da fehlt „Dei gratia“ und ihre Hemmung!
Die Gottgebundenheit bedingt, daß man sich nicht hemmungslos seinen Gefühlen, Leidenschaften, Neigungen hingibt, sondern bei allen seinen Handlungen durch die Hemmung der Verantwortlichkeit für sein Volk und Vaterland sich an Gott gebunden fühlt.
Daher nennen schon die alten Inder die Gottheit „Die große Hemmung“. Wir sollten darüber nicht lachen. Gelten sie zwar im herkömmlichen Sinne als Heiden, so sollten wir doch bedenken: Wie wenige von uns haben diese Hemmung! Zumal daheim im lieben Vaterland!
Die heutige Welt vermeint den Herrn Jesus Christus als Führer und Erlöser nicht mehr zu benötigen. Arbeit in Gottgebundenheit ist ihr völlig fremd. Egozentrisch sind gerade auch bei uns, in unserem unglücklichen, geknechteten Volk, die Leute geworden. Jeder arbeitet nur für sich, nie für die Allgemeinheit, für Volk und Vaterland. Ein Rennen nach Geld, Gut, Einfluß, Macht und Ansehen.
Das Zeitalter der Erfindungen erstaunlichster Art glaubt Christentum und Gott für sein Wirken nicht mehr zu nötig zu haben. Und doch, alle große Erfindungen, alles Wissen, alle Kunst, sind nicht imstande EINES zu tun:
Sie können keinen von der Sünde erlösen.
Das kann nur einer: Jesus Christus, unser Erlöser.
Darum müssen wir nicht ego-zentrisch, sondern christo-zentrisch sein.
Reben an ihm, dem Weinstock.
Von ihm uns führen lassen, ihm vertrauend folgend.
Im Strom und Drängen des Lebens ragt sein Kreuz auf Golgatha wie das gewaltige Signal:
„Halt! Ihr Menschen, besinnt euch! Sucht vor allem anderen nach Vergebung eurer Sünden, lasset euch versöhnen mit Gott durch mich, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, auch nicht in den Himmel kommen.“
Amen.
Dieses Dokument aus der Zeit des Exils (1919-1941) zeigt exemplarisch die zutiefst christliche Gesinnung Wilhelms II. sowie sein Verständnis von „Gottesgnadentum“ und „Gottgebundenheit“. Dieses spiegelt auch sein eigenes Herrschaftsverständnis wider: die klare Abgrenzung von absolutistischer, uneingeschränkter Macht einerseits, die große moralische Verpflichtung Gott und Volk gegenüber andererseits.
Im zeitlichen Kontext der Radikalisierung der Weimarer Republik infolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 läßt es der Kaiser auch an unzweideutigen Seitenhieben auf die erstarkende NS-Bewegung und ihren selbsternannten „Führer“ nicht fehlen.
Weiter